Rein, raus, weiterziehen. Ein Besuch in Groningen und der Blick auf die aktuelle Cannabispolitik mit dem Wietexperiment in den Niederlanden.
Die Leute kommen und gehen. Junge Frauen, Studierende, ältere Herren mit Einkaufstaschen. Es ist Freitag, der 2. Mai 2025, und ich stehe im Coffeeshop De Medley in Groningen. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren betrete ich wieder einen Coffeeshop – und vieles hat sich seitdem verändert.
Ich bin hier, um zu beobachten, wie die wichtigste Phase beim niederländischen „Wietexperiment“ angelaufen ist. In dieser Reportage möchte ich die Hintergründe beleuchten, spreche mit Shopbetreibern, Lieferanten und einer Wissenschaftlerin. Schnell wird klar: Das einstige Vorzeigemodell Coffeeshop steckte in einer Krise. Die Hoffnung liegt nun auf einer legalen Lieferkette – vom Anbau bis zur Ausgabe.
Bei Kaffee und Kuchen sitze ich mit Giulia, Inhaberin des Coffeeshops und Bekir, dem Manager, in einem Restaurant in der Nähe des Groninger Museums. Giulia betreibt De Medley seit über zwanzig Jahren – und hat schon im Dezember 2024, bevor es verpflichtend war, ausschließlich legales Cannabis verkauft. Seit dem 1. April dürfen die 75 Coffeeshops, die am Experiment teilnehmen, keine Produkte mehr aus der sogenannten „Hintertür“ – also illegale, denn nur der Verkauf war toleriert – anbieten. In ganz Groningen gibt es seitdem nur noch Ware von offiziell genehmigten regionalen Anbauern. Insgesamt 10 Kommunen beteiligen sich am Experiment.
Amsterdam ist nicht dabei. Man hatte Sorge, dass durch die Menge an Shops und die vielen Touristen nicht genug Ware zur Verfügung stehen würde. Auch besonders nahe zur Grenze zu Deutschland gelegene Städte machen nicht mit.

Denn insgesamt sollen erstmal zehn Produzenten, die in den Niederlanden eine Lizenz zum dortigen Anbau bekommen haben, die Shops beliefern. Aktuell sind sieben am Start, zwei davon aus der Region um Groningen. Einer davon ist Holigram, mit Beteiligung des Düngemittelherstellers Biobizz. Ein anderer ist Q-Farms, die u.a. mit dem bekannten spanischen Kollektiv und CSC La Kalada aus Barcelona kooperieren – das unter anderem Ice-o-Lator und Dry Sift liefert.
„Wir sind froh über das Wietexperiment“, sagt Giulia. „Endlich können wir legale und gute Produkte anbieten.“ Schon ab der ersten Woche lief der legale Verkauf besser als mit den Hintertür-Produkten – auch wenn es natürlich noch Luft nach oben gibt, vor allem bei der Verfügbarkeit. Manche Produzenten setzen mehr auf günstige Preise, andere auf Qualität. Es gibt Feedbackbögen für die Shops, und zwei- bis dreimal im Jahr Treffen zum Austausch mit den Produzenten und den Kommunen.
Hinter dem Tresen stehen meist Studierende – sie arbeiten zwei bis drei Tage pro Woche, 14 bis 20 Stunden. Für manche ist ist das wohl ein Traumjob. Alle neuen Verkäufer:innen bekommen einen Kurs vom Staat, damit sie richtig beraten und auch Risikokonsumenten erkennen können.





Wie sieht die Lage für die anderen Shops in Groningen aus?
Aktuell gibt es in Groningen neun Coffeeshops. Eigentlich wären laut städtischer Obergrenze 14 erlaubt, doch neue Lizenzen werden nicht mehr vergeben. Und auch die bestehenden Lizenzen, die im Zuge des Experiments eigentlich übertragbar gemacht werden sollten – etwa für einen Generationenwechsel –, durften plötzlich nicht mehr übertragen werden. Das könnte bedeuten, dass in den kommenden Jahren noch mehr Coffeeshops aus der lebendigen Studentenstadt mit 245.000 Einwohnern verschwinden.
Zwei Shops sollten gerade schließen wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und der Lagerung von zu viel Ware, haben aber per Gerichtsurteil noch eine Chance bekommen – darunter das Café Dees, einer der ältesten Coffeeshops der Stadt. In etwas rockiger Atmosphäre findet man dort sogar noch eine kleine Raucherterrasse. Eine Seltenheit. Die meisten anderen Shops erinnern inzwischen eher an amerikanische Dispensaries: kurz rein, kaufen und wieder raus.
Das ist schade. Denn das klassische Coffeeshop-Modell – sitzen, quatschen, konsumieren – hatte Charme. Doch seit dem 1. April 2020 ist das Rauchen – zumindest von Tabak – in der niederländischen Gastronomie verboten – das betrifft auch Coffeeshops. Nur ein separater Raucherraum ist noch erlaubt, aber den hat in Groningen niemand. Andere Shops geben das gemeinsame Konsumieren von alleine auf.
Ortswechsel: Besuch eines der ältesten Cafés der Stadt
Kunden stehen im Café Dees am Tresen und loben die neuen Produkte und geben mir Tipps. An der Bar steht Bas, der heute die Kunden bedient.
„Noch haben nicht alle Züchter ein komplettes Sortiment, aber das entwickelt sich – von Monat zu Monat wird es besser. Das Haschisch, das wir früher geraucht haben, gibt’s aktuell noch nicht, und mit traditionellem marokkanischem Hasch kann man es nicht wirklich vergleichen. Aber die Leute stehen auf die neuen Produkte, die vielen Sorten und die unterschiedlichen Geschmäcker.“
Alle Produkte sind mit einem Track-and-Trace-Code versehen, sodass die Regierung genau nachvollziehen kann, wo welches Cannabis landet. Von „Seed to sales“ ist alles trackbar, auch für die Konsumenten, denn auf den Verpackungen findet sich ein QR-Code zu diesen Informationen.
„Wir sind einer der letzten Orte in Groningen, an dem man noch in entspannter Atmosphäre gemeinsam einen Joint rauchen kann – die meisten anderen Läden in der Umgebung haben nur noch Take-away.“
Bas blickt dennoch optimistisch in die Zukunft:
„Ich bin überzeugt, dass sich das Wietexperiment in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Irgendwann können dann alle Shops ganz legal bei zugelassenen Züchtern einkaufen – und das Thema Hintertür hat sich erledigt.“
Ein anderer Shop, der etwas außerhalb der Innenstadt liegt, ist das Rag-a-Muffin. Auch hier läuft alles im Schnellmodus. Autos fahren vor, Kund*innen holen ihre Produkte und verschwinden wieder. „Früher hatten wir mehr Auswahl“, heißt es. „Jetzt sind wir auf die begrenzte Produktpalette der staatlich lizenzierten Anbauer angewiesen.“ Die Produkte werden hier ein bisschen wie in einem Apple-Store präsentiert.
In einigen anderen Shops habe ich meine Karte hinterlassen, besonders gesprächsbereit ist man jedoch nicht. Die Jahrzehnte der Zusammenarbeit mit illegalen Lieferanten und die damit verbundene notwendige Diskretion scheinen Spuren hinterlassen zu haben.
Preislich bleibt es moderat. Ab 5,50 Euro pro Gramm geht es los, die meisten Sorten liegen zwischen 7,50 Euro und 12 Euro. Beim Hasch gibt es allerdings noch Probleme – vor allem, weil viele das klassische marokkanische Haschisch vermissen. Deshalb dürfen die am Experiment teilnehmenden Coffeeshops noch bis September auch illegal importiertes Hasch verkaufen.







Heritage und Investments in die Zukunft: Gespräch mit einem der Lieferanten
Wie sehen die Anbauer selbst das Experiment? Ich kontaktiere Holigram, einer der 10 zugelassenen Lieferanten per Mail. Patrick Stevens, der Key Account Manager, antwortet schnell. „Wir sind im Moment sehr beschäftigt, dass wir kaum Zeit für Interviews haben – aber stell mir gerne ein paar kurze Fragen“, schreibt er.

Wie liefen die ersten Wochen für euch? Wie viele Produkte habt ihr auf Lager und was ist noch geplant?
„Wir haben eigentlich schon Ende Februar angefangen zu verkaufen. Aber seit dem 7. April ist definitiv mehr los. Seit diesem Tag dürfen die Shops nicht mehr auf ihre „Hintertür“-Lieferungen zurückgreifen. Deshalb stehen die Shops Schlange bei uns und anderen Produzenten. Wir sind also sehr beschäftigt mit der Bearbeitung und Verpackung der Bestellungen. Gestartet sind wir mit zwei Sorten, dann haben wir auf fünf erweitert, und bis Ende Mai sollen es sechs sein.“
Welches Feedback kommt aus den Shops?
„Überwiegend positives. Die Shops wissen, dass sie ein sauberes, getestetes Produkt bekommen und dass die nächsten Chargen die gleiche oder sogar bessere Qualität haben werden. Allerdings sind viele Produzenten noch nicht gut mit Haze-Sorten bestückt, die sehr gefragt und schnell ausverkauft sind. Es gibt also noch Luft nach oben.“
Wie seht ihr die Entwicklung des Wietexperiments in den kommenden Jahren?
„Mit einer transparenten Versorgung durch lizenzierte Produzenten hoffen wir, die öffentliche Meinung über Cannabis wieder zu verändern. Viele Menschen verbinden es immer noch mit Kriminalität und Schwarzgeld. Durch das Experiment können wir helfen, Vorurteile und Stigmata abzubauen. Es wird Zeit, Cannabis in den Niederlanden die Anerkennung und Freiheit zu geben, die es verdient.“





Von Groningen ins ganze Land
Was sich in Groningen abspielt, ist teilweise deckungsgleich mit der gesamten Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Denn das einst bewunderte liberale Duldungs-Modell musste Federn lassen.
Die Zahl der Coffeeshops in den Niederlanden ist seit den 1990ern deutlich gesunken – von rund 1.450 1993 auf etwa 565 im Jahr 2020. Besonders in Amsterdam wurde stark reduziert, trotzdem gibt es dort immer noch die meisten Läden, etwa ein Drittel aller Shops im Land. Der Rückgang liegt vor allem an strengeren Regeln, lokalen Auflagen und Beschwerden der Anwohnenden.
Kriminalität im Umfeld der Shops und Probleme durch illegale Lieferanten
Das Wietexperiment soll nun endlich die alte „Hintertür“-Problematik lösen: Der Verkauf in Coffeeshops ist zwar geduldet, aber die Belieferung blieb illegal. Das hat die Shops in die Grauzone gedrängt – mit allen Problemen wie illegalen Lieferanten und fehlender Kontrolle.
Und ja, man darf die Augen nicht verschließen: Durch die jahrelange illegale Hintertür hat sich rund um einige Coffeeshops eine merkwürdige Szene entwickelt. Dealer stehen in Gruppen um einige Shops herum, aus Bluetooth-Boxen dröhnt laute Musik, und Berichte über Schlägereien, Messerstechereien und andere kriminelle Vorfälle in und bei den Shops sind leider keine Ausnahme. Selbst Sprengsätze und Brandanschläge gab es schon. Auch ist Cannabis ja nur ein Produkt der bisher illegalen Lieferanten und somit leidet die Droge auch darunter, dass sich die Niederlande insgesamt zu einem der Big Player im europäischen Drogenhandel entwickelt haben.
Viele Gegner der Liberalisierung werfen Befürwortern genau das vor. Die offene Haltung gegenüber Cannabis hätte dazu geführt, dass andere Drogen und der damit verbundene Handel salonfähig wurden. Ob da was dran ist, habe ich noch nicht untersucht, aber es klingt zunächst einmal nicht völlig abwegig.
All diese Entwicklungen haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass immer mehr Nachbarschaften sich strikt gegen neue und teilweise auch eingesessene Coffeeshops wehren. Es ist schwer, neue Standorte zu finden. Selbst in Industriegebieten wollen angrenzende Firmen die Shops, auch als neuartige Form der Take-Aways, nicht in ihrer Nähe haben.
Auch beim Wietexperiment gibt es Schwierigkeiten im Umfeld der Farmen. Bei einem der neuen staatlich lizenzierten Anbauer beschwert sich die Nachbarschaft über den starken Geruch aus den Gewächshäusern. Der Weed-Geruch sorgt bei den Anwohnern für Kopfschmerzen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Das gesellschaftliche Klima ist also unentspannter als in den 80ern. Eine moderne Cannabispolitik hat es auch in den Niederlanden nicht leicht, obwohl alle hoffen, dass sich mit dem Zurückdrängen der illegalen Lieferketten einige dieser Probleme zukünftig lösen lassen.
Mit dem Experiment will die Regierung jetzt eine komplett legale Kette schaffen – vom Anbau bis zum Verkauf. Ziel: weniger Kriminalität, bessere Qualität und mehr Schutz für die Konsumenten. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet, um zu sehen, ob es auch langfristig funktioniert.

Was sagt die Wissenschaft dazu?
Nicole Maalsté ist eine niederländische Sozialwissenschaftlerin und eine der führenden Expertinnen für Cannabisforschung in den Niederlanden. Seit über 25 Jahren untersucht sie illegale Märkte, insbesondere im Bereich Cannabis, und berät Behörden, Polizeien und politische Entscheidungsträger zu Fragen der Drogenpolitik. Zu ihren bekanntesten Publikationen zählen die Bücher „Polderwiet“ (2007) und „De wietindustrie – de slag om de achterdeur“ (2015). “Polderwiet“ ist ein informeller Begriff, der die Herkunft des Cannabis aus den typischen flachen Landstrichen der Niederlande beschreibt.
Nach meinem Besuch in Groningen habe ich ihr ein paar Fragen zu meinen Beobachtungen gestellt. Wohin entwickeln sich die Coffeeshops, was machen die einstigen Lieferanten heute?
Die Coffeeshops sind anders als früher, eher wie Dispensaries. Ist diese Veränderung spezifisch für Groningen oder ist sie Teil eines allgemeinen Trends in den Niederlanden?
„Während der Pandemie haben immer mehr Coffeeshops auf dieses Modell umgestellt. Ein zweiter Grund ist, dass einige der Coffeeshops in Groningen neuen Geschäftsleuten gehören, die Ketten von Coffeeshops im gleichen Stil aufbauen.“
Unterstützt die derzeitige Regierung das Wietexperiment noch ausreichend, oder besteht die Gefahr eines politischen Rückschlags?
„Politiker und Policy Maker sind zwei verschiedene Dinge. Die Policy Maker in Den Haag sind nach wie vor stark involviert. Die Politiker scheinen nicht sehr interessiert zu sein, und das sollte auch so bleiben, denn sie scheinen keine Ahnung vom Cannabismarkt zu haben.“
Was ist aus den alten Lieferanten geworden? Wird jetzt mehr Cannabis nach Deutschland oder in andere EU-Länder exportiert?
„Das weiß niemand. Aber nach Deutschland oder in andere EU-Länder zu exportieren, erscheint mir nicht logisch. Wir haben immer noch einen großen illegalen Markt (30-45%), auch in den Städten, in denen man legale Produkte kaufen kann. Die illegalen Lieferanten können ihre Produkte auch in Städten verkaufen, die sich nicht an dem Experiment beteiligen. Vor dem 7. April berichteten mir einige Coffeeshop-Besitzer aus Städten in der Nähe der Versuchsstädte, dass sie neue Kunden in Coffeeshops sahen, die nicht am Experiment teilnehmen. Nur 75 Coffeeshops nehmen an dem Experiment teil. Etwa 500 nehmen nicht teil und verkaufen weiterhin die üblichen Produkte.“
Wie geht es weiter – ist eine Rückkehr zum alten Hintertür-Modell am Ende des Experiments 2029 denkbar?
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum alten System zurückkehren werden. Natürlich ist das Wietxperiment aus politischen Gründen so angelegt. Einige politische Parteien würden einem Experiment niemals zustimmen, wenn es nicht genau so gestaltet wäre.“
Ich frage mich: Was bedeutet das für Deutschland?
Im grünen Flixbus verlasse ich die Niederlande mit gemischten Gefühlen.
Auf der einen Seite zeigt sich in Groningen eine moderne, produktorientierte Take-Away-Landschaft – legal und kontrolliert. Auf der anderen Seite scheint dabei auch ein Teil des alten Charmes, der einstigen Coffeeshop-Kultur, verloren zu gehen. Ob sich der illegale Markt oder andere Probleme damit verringern lassen, muss sich noch beweisen.
Während hierzulande noch immer 32 Modellprojekte von Kommunen und Städten auf grünes Licht für ihre wissenschaftlich begleiteten Abgabestellen warten, ist in den Niederlanden der Praxistest gestartet. Auch in der Schweiz laufen vergleichbare Projekte, mit Abgabe in Fachgeschäften bis hin zu Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Nur: In allen Ländern braucht es Geduld. Die Prozesse sind komplex, der gesellschaftliche und politische Diskurs bleibt zäh. Jahre gingen ins Land. Das Wietexperiment endet 2029 mit einer großen Evaluation.
Schnellschüsse wird es keine geben – nicht in Deutschland, nicht anderswo. Aber vielleicht kann gerade der niederländische Weg mit all seinen Widersprüchen auch ein Lehrstück für unsere Zukunft auf dem Weg zur vollen Legalisierung sein. Wenn er ein Erfolg wird.
Timeline des Wietexperiments in den Niederlanden
2017: Politische Entscheidung zur Durchführung des Experiments
2020: Rechtliche Vorbereitung und Auswahl der teilnehmenden Kommunen
Dezember 2023: Start der ersten Phase in Breda und Tilburg (kombinierter Verkauf von legalen und illegalen Produkten)
September 2024: Start der weiteren acht Städte. Bedingung: Eine Wochenlieferung von einem regulierten Anbauer und 500 Gramm Gras und Haschisch von der Hintertür.
7. April 2025: Beginn der vollständigen Umstellung in den 10 Kommunen, in denen Coffeeshops ausschließlich legal produziertes Cannabis verkaufen dürfen
2029: Geplante Auswertung der Ergebnisse zur Entscheidung über eine mögliche
landesweite Einführung
Vielen Dank an alle Beteiligten für die Offenheit, Zeit und Mühe!
Disclaimer: Dieser Gastbeitrag stammt von CannaEcho. Ihr findet sein Profil auf Reddit oder Instagram. CannaEcho steht für deutschsprachigen Cannabis-Journalismus unter dem Motto: Unabhängig. Unbezahlt. Unaufhaltsam. Wichtig: Cannabis-Konsum ist nicht ohne Risiken, vor allem für Personen unter 25 Jahren. Informiere Dich unbedingt und treffe Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten.
Hier geht es zu GD420’s ersten Begegnung mit dem Zoll an der niederländischen Grenze.



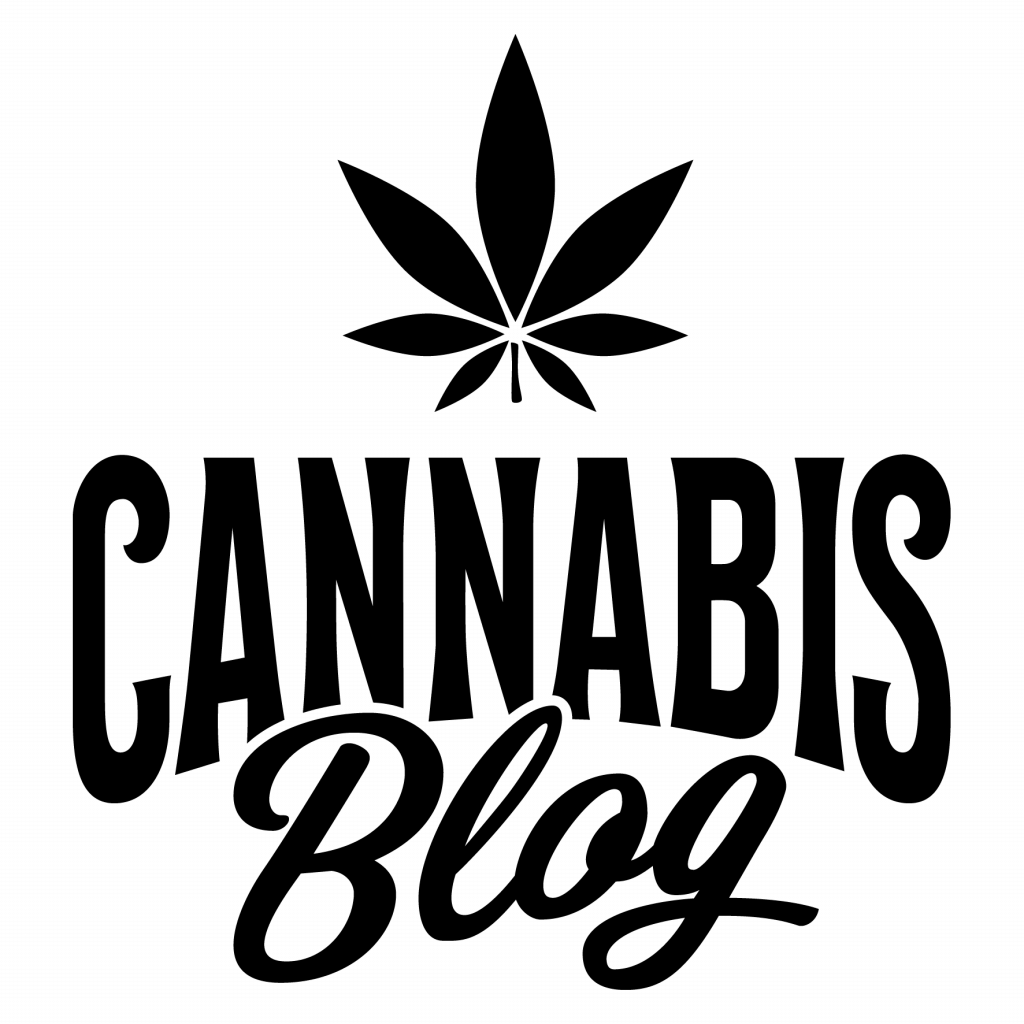
Schreibe einen Kommentar